2. Frage
Kann man das ‚Juristische Lehren‘ lernen?
Ja! Natürlich kann man das! Man kann lernen, ein guter Dozent zu sein. Gute Lehre ist kein Zufall, sondern sehr viel Mühe und Arbeit. Man muss sich möglichst schnell ein „Survival package“ zulegen mit den Antworten auf einige wichtige Überlebensfragen.
Fast alle Juradozenten beginnen ihr Dozentendasein ohne Vorkenntnisse über die Kunst des juristischen Lehrens. Juristische Fachdidaktik? – Fehlanzeige in den Ausbildungsstätten und Hochschulen selbst, wie auch auf dem ansonsten doch so überquellenden juristischen Büchermarkt! Deshalb möchte ich versuchen, Ihnen mit meinen Gedanken und Erfahrungen zu helfen bei Ihrer Verwandlung vom juradozentischen Greenhorn zum erfolgreichen Juradozenten, möchte Ihnen die Angst vor dem Neuen, die permanent-latente nervöse Unruhe vor der nächsten Lehrstunde nehmen, möchte Ihre vorhandene dozentische Neugier (sonst läsen Sie nicht diese Zeilen) in didaktische Wissbegier ummünzen. Es gibt nichts Schöneres und vor allem Sinnstiftenderes für einen begeisterten Juristen als sein juristisches Wissen an junge Menschen der nächsten Generation weiterzugeben, was sich Unbeteiligte nur schwer vorstellen können.
Eigentlich ist Lehren für Sie als juristische Lehrkraft ja nichts anderes als etwas schon von Ihnen juristisch Gelerntes wieder in Lernen zu verwandeln. Juralehren heißt also, sein gelerntes und beherrschtes Juraweltwissen wieder in Juraweltwissen bei den Studenten umzumünzen. Ganz einfach! Und doch so unendlich schwer, weil zwischen dem Erlernen von Jura und der Wiedergabe des Erlernten die zu erlernende Welt der juristischen Fachdidaktik liegt. Dafür muss man Jura zum zweiten Mal lernen und die Didaktik noch obendrauf.
Sie kommen als Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt, Praktiker des Rechts oder als professoraler Theoretiker des Rechts mit hoher Autorität ausgestattet, mit vielen Vorschusslorbeeren zu Ihren Studenten. Glauben Sie: Man freut sich auf Sie. Sie geben Einblicke und Ausblicke in juristische Berufsfelder und durchleuchten das geheimnisvolle Recht und Gesetz. Aber wie? Wie sollen Sie das machen? Was sollen Sie tun? Rechtsunterricht haben Sie zur Genüge erhalten auf der Uni und in den Referendararbeitsgemeinschaften. Das Beste davon müssen Sie nun in Ihrem eigenen Rechtsunterricht kondensieren und didaktisch umsetzen.
Aber wo taucht diese Welt der „Juristischen Didaktik“ in Lernbüchern auf? – Nirgendwo bis selten! – Warum diese fehlenden Antworten auf die praktische Frage „Wie lehre ich Jura?“ Warum hat die juristische Didaktik bisher so wenig Zuwendung erfahren?
- Eine erste Erklärung kann sein, dass in der landläufigen Meinung vieler Dozenten das „Lehren von Jura“ ein Vorgang ist, der von selbst funktioniert, dass jeder, der Jura studiert hat – quasi angeboren oder anerzogen – über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt. Lehren sei eben nicht lehrbar. Jeder war doch einmal Schüler und Student und hat in seiner schulischen und universitären Sozialisation eine Unmenge von Lehrern, juristischen Dozenten und Professoren erlebt. Aber: Kann man deshalb schon richtig lehren? Niemand fällt als Meister des juristischen Lehrens vom Himmel. Niemand steht morgens mit dem Satz auf: „Ab heute bin ich ein perfekter Jura- oder Rechtskundedozent“.
- Eine zweite Erklärung für die geringe Beachtung von Lehrfragen in der juristischen Literatur könnte sein, dass Fragen der juristischen Didaktik innerhalb der heiligen Hallen einer wissenschaftlich-juristischen Institution ganz einfach keinen Platz haben dürfen. Lehren sei eben auch nicht lernbar Aber: Warum eigentlich nicht? Warum diese Arroganz gegenüber der Didaktik? Man hat manchmal den Eindruck, als gehöre es sich nicht, ein Didaktikproblem zu haben – aus Angst, vor den Kollegen als unfähig dazustehen. Doch – es gehört sich!
- Eine dritte eher selbstsüchtige Erklärung: Es gibt zwar bei so manchem Dozenten eine feine juristische Didaktik, die literarisch zu offenbaren die jura-dozentische Nächstenliebe eigentlich geböte, forderten der jura-dozentische Egoismus, der Ehrgeiz und die Eitelkeit aber nicht Verschwiegenheit.
Auf den Punkt gebracht:
- Die Einen glauben: Juristisches Lehren sei nicht erlernbar (Naturtalenttheorie).
- Die Anderen glauben: Juristisches Lehren sei erlernbar, aber nicht lehrbar (Autodidaktiktheorie).
- Wieder andere meinen: Juristisches Lehren sei erlernbar, auch lehrbar, aber man behalte es für sich (Selbstsuchttheorie).
- Die Könner aber wissen: Juristisches Lehren ist erlernbar, lehrbar und vermittelbar (Didaktiktheorie).
Ich schließe mich der letzten Meinung an. Es gibt nämlich auf diesem Gebiet eine Menge bestimmter Regeln, Erfahrungen, „Rezepte“ und Maximen des juristischen Lehrens, die von allen juralehrenden Spezialisten erlernt, gelehrt und übernommen werden können. Man muss eben nur wollen.
Viele ältere Kollegen werden den jungen Kollegen im Laufe ihrer ersten Zeit erzählen, dass man das Dozieren niemals lernen könne. Entweder man habe eine didaktische und methodische Begabung, oder man habe sie nicht – das Beste sei, die „Neuen“ sofort darauf vorzubereiten, diese Tatsache ganz einfach zu akzeptieren. (Schwierige Zwischenfrage: Wie lässt sich etwas von der juristischen Lehrtradition Abweichendes denken, wenn das Denken dieser Kollegen selbst ausschließlich von dieser Tradition geprägt ist?)
Sicherlich gehört zu einem Juradozenten, der in seinem von ihm selbst geschriebenen „Lehr-Stück“ sein eigener Regisseur, Dramaturg, Schauspieler und Souffleur ist und ständig zwischen den Extremen „Priester“ und „Clown“ hin- und herwandert, wie zu jedem anderen künstlerischen Beruf, eine gehörige Portion Talent – aber eben nicht nur! Der im brieflichen Dialog des Vorwortes wiedergegebene Ratschlag des Altkollegen nützt Dozenten, die keine Lust haben, ihr Lehr- und Lernverhalten zu hinterfragen, bewusst zu kontrollieren und zu verändern. Mit diesem Totschlagargument „Man kann’s, oder man kann’s nicht!“ kann man sich bequem zurückziehen und obendrein noch stolz darauf sein, dass man ja schon immer gegen „didaktischen Theoriekram“ gewesen sei. Die Formel dient – mit Verlaub – der Faulheit! Wenn optimales, effektives Dozieren wirklich nur aus spontanem, natürlichem, intuitivem, gottgegebenem Gewohnheitsverhalten und Talent hervorginge, verdiente die Didaktik nicht den Namen einer anerkannten Wissenschaft. Sicherlich lässt sich Vieles zum Thema Lehren und Dozieren lernen – diesen Versuch erst gar nicht zu unternehmen, ist ein arrogantes Versäumnis! Lehren ist lernbar und nicht nur eine Frage individueller Begabung. Aber es geht nicht ohne rechtsdidaktische Reflexion!
Der juristische Dozent hat das Problem, dass er selbst fachdidaktisch unausgebildet ist, keine umfängliche Lehr-Präparation erfahren hat und in seinem Studium die Juristerei an der Hochschule durch seine Dozenten häufig didaktisch nicht vorbildhaft vermittelt bekommen hat. Wie soll er lehren, was er nicht gelernt und als Vorbild nicht erlebt hat?
- Er muss zunächst selbst lernen, wie man juristisch lehrt, bevor er juristisch lehren kann.
- Er muss das juristische Wissen für seine Lehre noch einmal neu erwerben. Denn, wie gesagt, es gilt der Satz: „Wer juristisch lehren will, muss die Juristerei zweimal lernen – und die Didaktik noch dazu!“
- Er hat kein Rezept, geschweige denn ein patentes, dem Vorlesungs- und Unterrichtsdruck aufgrund der Stofffülle, die er vermitteln soll, wirksam zu begegnen.
- Er wurde als Dozent ausgewählt nach fachlich-sachlichen Kriterien, weil er ein guter Jurist als Richter, Staatsanwalt, Anwalt, Wissenschaftler oder Rechtspfleger war und wurde freundlich „Dozent“ getauft. In diesem beschönigenden Begriff drückt sich die Erwartung aus, dass ihm sofort und ohne weitere Unterweisung die Metamorphose vom Rechtsanwender zum Rechtsvermittler gelingen möge. Er hat aber „dozieren“, d.h. lehren, lehrhaft vortragen, niemals gelernt, sondern die Juristerei studiert, um zu richten, zu verhandeln, zu plädieren, zu entscheiden, zu verwalten, zu forschen, jedenfalls nicht um zu lehren.
Allein – Sie haben sich irgendwann freiwillig mit didaktischem Todesmut für eine Lehrtätigkeit entschieden, womit Sie Idealismus, Mut, Tatkraft, Flexibilität, Entschlusskraft, Risikobereitschaft, keine Angst vor kaltem Wasser und „Ich-weiß-nicht-was-sonst-alles-für-Eigenschaften“, jedenfalls nicht zuletzt ein hohes Interesse oder zumindest eine große Geneigtheit zum Lehren und damit zur Didaktik bewiesen haben. Es ist ein verdammt kaltes Wasser, in das Sie da gesprungen sind. Da kann so manch einen frösteln.
Ein weiteres Problem kommt hinzu: In der Hermeneutik, der Auslegekunst, geht man davon aus, dass es viele Themen und Probleme in unserer Welt gibt, die wir „irgendwie“ schon kennen, die wir aber nicht gründlich genug verstehen. Auf die juristische Lehre übertragen heißt das, dass wir alle schon „irgendwie“ zu wissen meinen, was didaktisch „Sache“ ist! Immerhin sind wir ja 12 oder 13 Jahre in die Schule gegangen, haben jahrelang studiert und eine Unmenge von Pädagogen und Dozenten kennengelernt. Im Rückspiegel unserer Sozialisation fühlen wir uns deshalb in einem diffusen Sinne „irgendwie“ als „Dozentenprofis“. Aber Vorsicht! Unser didaktisches Wissen ist vielfach nur flüchtig, unreflektiert, unausgegoren, oberflächlich, vorurteilsbeladen, widersprüchlich und unwissenschaftlich.
Man kann jeden Lehrwilligen nur ermuntern, sich möglichst schnell zum selbstbestimmten, didaktisch gut vorbereiteten Dozenten zu emanzipieren. Das Dozieren sollte zu einem eigenen Lebensstil werden, ja zu einer dozentischen Ethik führen. Diese umfasst die Summe der Verhaltens- und Bewusstseinsnormen, nach denen sich Dozenten von oben behandeln lassen, nach denen sie miteinander umgehen und … nach denen sie ‑ und darauf kommt es hier nur an – ihre Studenten behandeln. Mittelmäßige Dozenten hören nicht deshalb auf, mittelmäßig zu sein, nur weil sie vor Studenten stehen und Jura lehren. Nichts ist gefährlicher als der Verlust des didaktischen Ethos – Verantwortung gegenüber den Studenten – und des didaktischen Eros – Liebe zu den Studenten.
Ihr „neuer Beruf“ als Dozent ist übrigens kein ganz so „blinder Fleck“ für Sie als der neu in der Lehre Ankommende. Sie marschieren gar nicht ganz ohne Wegbeschreibung, Landkarte und Vorbilder in das „feindliche“ Territorium des juristischen Hörsaals.
- Es stimmt schon! Jeder Juradozent war einmal Schüler, Auszubildender, Student und Referendar und hat folglich eine Unsumme bestimmter Bilder von Lehrern und Dozenten, Professoren, Tutoren, Repetitoren und Ausbildern verinnerlicht. So verfügt der junge Dozent bereits über eine „Urdidaktik“, über eigene, durch seine spezifische Schul- und Hochschulausbildung und seine Lebensgeschichte geprägte Vorstellungen von guten und schlechten Lehrern und Dozenten, von gutem und schlechtem Lehrbetrieb. Sie sollten sich zunächst einmal Ihre vorhandenen Lehr- und Unterrichtsbilder, Ihre „naiven“ Lehr- und Dozentenvorstellungen bewusst machen und die im Gedächtnis vorhandenen und kartografierten Spuren vergangener Lehr- und Lernerfahrungen auf diesem Gebiet des Unterrichtens und Unterrichtetwordenseins Bevor Sie Ihr Abitur gemacht haben, haben Sie rund 15.000 Unterrichtsstunden absolviert, in Hochschule und Praxis erneut eine Menge „Lehrer“ erlebt, genug, um bestimmte Begriffe und Anschauungen von „Lehre“ und „Vorlesung“ im Hinterkopf zu haben. Diese gilt es, zu reflektieren und … gegebenenfalls zu korrigieren! In jedem Dozenten sollte sich mit dem Lehrbeginn ein intellektuelles Unbehagen regen, das ihn dazu bringt, seine seit Schüler- und Studentenzeiten verinnerlichten „Lehrer-Schüler-Dozenten-Studenten-Bilder“ im Hinterkopf zu überdenken und zu hinterfragen. Dies sind Bilder von guten und geliebten Lehrern ebenso wie von schlechten und gehassten Lehrern, von großen Peinlichkeiten und Katastrophen und kleinen Glücksfällen in Unterricht, Vorlesung, von Horrorszenarien der Anfängervorlesungen, von gerechten und ungerechten Lehrern und Dozenten, von Unterrichtseinheiten, in denen nichts lief, ebenso wie von Unterrichtseinheiten, in denen die Zeit wie im Fluge verging. Jeder kennt didaktische Sternstunden – aber eben auch didaktisches Chaos.
- Auch kennt man die beiden extremen Dozententypen aus der eigenen Studentensozialisation.
- Der eine weiß hundertzwanzig Prozent über sein Grundbuch, sein Familienrecht, sein Strafrecht oder sein BGB – er beherrscht einfach alles! Aber sein Unterrichtsstil ist oftmals einschläfernd, undynamisch, monoton, sein Sprachniveau viel zu abstrakt, gestelzt und gedrechselt, seine Denkweise zu kompliziert, zu verbildet und zu verwinkelt. Der juristische Überflieger weiß eben häufig nicht, wie es am Eingang des juristischen Gebäudes aussieht und wird damit zum rechtswissenschaftlichen „Nichtjuristenausbilder“. Die Gefahr bei diesen vortrefflichsten Juristen unter den Dozenten besteht darin, dass sie – jedenfalls am Anfang des juristischen Verstehens – keiner hören will, weil am Anfang nicht jeder Vortrefflichstes gleich verstehen kann. Nicht immer sind gerade die sogenannten „Einserjuristen“ die besten Dozenten, sondern die, die selbst während Studium und Praxis hart an sich und hart am Stoff arbeiten mussten, für die der Satz gilt: 90 % Prozent der Juristerei werden auf dem Hintern erworben, denen es nicht zugeflogen ist in Gottes Namen, sondern die es einpauken mussten in Drei-Teufels-Namen.
- Der andere dagegen beherrscht nur achtzig Prozent seines Stoffes, aber die bringt er „optimal rüber“. Sein Stil ist lebendig, immer fallbasiert, interessant, mitreißend, sein Sprachniveau der Umgangssprache entsprechend einfach, bildhaft, konkret und vorwiegend mit Hauptsätzen bestückt, seine Denkweise gut strukturiert und stringent, seine Visualisierung durch Baumdiagramme, gute Tafelarbeit und Fallskizzen lehrreich. Er ist der weit bessere Juristenausbilder. Es gibt sie, diese Mischung aus juristischem Wissen und strahlender Lehrkunst: Persönlichkeiten mit natürlich-naiver rationaler und nicht qua Amt „geliehener“ irrationaler Autorität, die immer eine Aura des Sonnenscheins ausstrahlen, mit Pointen und Witzen aufwarten können, ihr „fundiertes“ 80prozentisches Wissen „fundierend“, blendend und locker zu 80 % an die Studenten bringen, ständig Licht in die Dunkelheit der Gesetze senden. Die, die eben „gute“ Dozenten sind, bei denen es im Paragrafendschungel lichter und nicht dämmriger wird. Aber die sind sehr rar und jeder kann von ihnen nur lernen. Und nur selten sind sie eben im Reservoir der exzellenten Juristen zu finden!
Die „Überflieger“ haben nur selten das Gespür für die Schwierigkeiten erlebt, die „Jura-Ottonormalverbraucher“ mit dem juristischen Stoff hat. Während jene Genialen über die dornigen und verschlungenen Pfade und Niederungen des grauen juristischen Ausbildungsalltages stürmisch hinwegflogen, mussten diese sich mit Axt und Machete mühsam Meter für Meter ihren Weg zum Gipfel – sprich Examen – bahnen. Sie haben durch permanentes Stolpern und schmerzhafte Risswunden den Weg durch den Dschungel der Paragrafen, Lehrbücher, Rechtsprechung und Vorlesungen gefunden. Am Ende der Wildwuchsstolperstrecke stand das Examen, und sie sind noch heute dank ihrer Narben der Schwierigkeiten eingedenk, die sie überwinden mussten. Sie erinnern sich auch als Dozenten immer wieder der eigenen Mühen und Schmerzen – und können daher besser die Mühen und Schmerzen der mit Axt und Machete zum Aufbruch Bereitstehenden nachempfinden. Sie wissen eben noch, dass jeder „juristische Schmetterling“ auch einmal eine „juristische Raupe“ war.
- Neben diesen „untheoretischen und unverbildeten“ Bildern von dozentischem Modellverhalten aufgrund der eigenen juristischen Sozialisation verfügt der „Debütant“ über einen weiteren Fundus, aus dem er von Anfang an schöpfen kann und schöpfen sollte. Es sind dieselben menschlichen Handlungsweisen, die er auch im Alltag gegenüber seinen Mitmenschen verwendet. Mit anderen Worten – er sollte so interagieren, wie er mit anderen näherstehenden Erwachsenen im alltäglichen Umgang auch interagiert.
- Er sollte seine Studenten genau so anlächeln, wie er seine Kinder anlächelt oder seine Freunde. Es gehört nicht zu seinen Pflichten, in seinem Gesicht ständig die Schwere seines beruflichen Amtes abzubilden, ebenso wenig, wie permanent den Strahlemann zu spielen.
- Er sollte seine Studenten loben, wenn sie es verdienen, genau so, wie er es in seiner Familie oder seinem Freundeskreis tut.
- Er sollte seine Studenten genauso wenig anlügen, wie er es gegenüber seinen privaten Mitmenschen tut.
- Er sollte nicht verkrampfen, seine schlechte Stimmung nicht mit Gewalt verbergen, sondern sie lieber in der Form von sogenannten „Ich-Botschaften“ mitteilen.
- Er sollte nie etwas versprechen, was er nicht halten kann. Wenn er etwas verspricht, muss er es aber auch unbedingt einhalten. Man muss ihm vertrauen können. Eine Klausur muss dem Versprechen „Die wird ganz einfach!“ auch entsprechend fair konzipiert, transparent und nachvollziehbar korrigiert und pünktlich zurückgegeben werden.
- Er sollte keine Scherze machen, über die ganze Studiengruppen lachen können, nur ein einzelner Student nicht – auch im Alltagsleben ein schlechtes Profilierungskonzept. Das Motto: „Lieber einen Studenten verraten als eine Pointe auslassen!“ gehört sich für ihn einfach nicht!
- Genauso, wie am Arbeitsplatz, im Sportverein oder im Privatleben sollte ein In-den-Arm-nehmen oder ein Auf-den-Rücken-klopfen durchaus von ihm gewagt werden, wenn dabei der pädagogische Takt gewahrt wird. Studenten können heute sehr gut unterscheiden, was plumpe sexuelle Annäherung oder ungezügelte Aggression und was ein körperlich ausgedrücktes Einvernehmen oder eine spontane Sympathiekundgebung sind.
- Schließlich hat der junge Dozent im Regelfall eine berufliche Praxis durchlaufen, ein großer Schatz für einen Dozenten. Der Reiz jeder juristischen Ausbildung ist und bleibt immer noch die Falllösung, die praktische Umsetzung des theoretischen und methodischen Wissens auf einen Lebenssachverhalt. Und dazu kann er im Regelfall eine Menge beitragen, es sei denn, er hat als Professor eine rein wissenschaftlich-akademische Laufbahn und damit die Berufsferne hinter sich. Die berufspraktische Orientierung ist an den juristischen Fakultäten verpönt und wird trotz anderslautender Lippenbekenntnisse fast verachtet. Es regiert die Frage, wer am meisten veröffentlicht, nicht wer am meisten praktisch gearbeitet hat. Aber der vollkommene Rechtslehrer ist nun einmal die Kombination aus Rechtsgelehrtem und Rechtspraktiker, mit ihren jeweiligen Primär- und Sekundärtugenden. Man darf die juristischen Praktiker nicht vor der Theorie bewahren, die Theoretiker aber auch nicht vor der Praxis. Zwar ist der Gegenstand der Juristerei – das Gesetz - nun einmal abstrakt und hat keine Sezierleichen, Werkbänke oder Labore zu bieten. Aber veranschaulichen kann man es sehr wohl, besonders aus der Erfahrungswelt der praxiserfahrenen Dozenten wie aus der Alltagswelt der Lernenden! Statt „Experiment“ haben wir den „Fall“! Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, und das kann der Berufspraktiker einbringen wie kein Zweiter: das theoretische Verstehen von Recht und Gesetz und die praktische Anwendung von Recht und Gesetz.
Sie verfügen also bereits über 4 ganz wesentliche didaktische Handlungsorientierungen, ohne es vielleicht gewusst zu haben:
- Zum einen über Ihre individuellen Dozenten- und Unterrichtsbilder,
- zum anderen über Ihre biografische Alltagslehrerfahrung,
- schließlich über Ihre mitmenschlichen Umgangskompetenzen
- und letztlich über Ihre Berufspraxis.
Eine ganze Menge, oder? Da Sie nun auch noch über die kommunikative Ur-Kompetenz, d.h. das Sprechen und Sich-verständigen-können in verbaler wie nonverbaler Art zu verfügen glauben, könnten Sie eigentlich mit dem Dozieren loslegen. Damit entsprächen Sie – wie gesagt – der Meinung vieler Altdozenten (siehe Briefwechsel im Prolog), die meinen, das eigene unterrichtsmethodische Talent sei durch nichts, schon gar nicht durch Theoriegeklapper zu ersetzen; es komme gerade auf die konstruktive Abnabelung vom rechtsdidaktischen Theoriewissen an. Man sollte diesen Besserwissern, die sich in jedem Kreis von Lehrkollegien eingenistet haben, nicht vertrauen und getrost und neugierig zum Didaktik-Lern-Buch greifen! Eben: Lernen, Jura zu lehren! Man kann es lernen!
Ihr Dozentenschicksal ? – Nein! Sie lernen das „Juristische Lehren“!
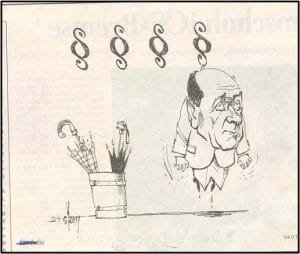
Um sich gleich zu Beginn besser persönlich einschätzen zu können, hier eine kleine Palette von konkreten, kritischen Fragen, die Sie sich als juristisch Lehrender vor Augen halten müssten, bevor Sie Ihre erste Lehrstunde beginnen.
- Über welche verbale und nonverbale Ausdrucksfähigkeit verfüge ich?
- Wie steht es um meine physische Kondition und Konstitution, also um meinen Körper?
- Über welche stimmliche Modulationsbreite verfüge ich?
- Was ist meine Persönlichkeitsstruktur? Wie ist mein Charakter? Bin ich eine Dozentenpersönlichkeit?
- Wie steht es um meine psychische Konstitution, wie bin ich „drauf“, wie stabil bin ich?
- Wie viel Emotionalität ist mir eigen?
- Wie steht es um meine soziale Kompetenz?
- Wo stehe ich politisch, und wie ist meine gesellschaftliche und politische Orientierung?
- Habe ich didaktisch-theoretische Kompetenz, die ich nicht nur für wünschenswert, sondern für einen professionellen Unterricht für unverzichtbar halte oder nicht?
- Habe ich didaktisch-praktische Kompetenz, eine entscheidende Instanz, ohne die kein Dozent gut unterrichten kann?
- Wie fundiert, in Breite und Tiefe, ist mein juristisches Fachwissen?
- Welche eigene Lebens- und Berufserfahrung habe ich gemacht?
- Bin ich zufrieden oder unzufrieden, passioniert oder frustriert im Beruf?
- Habe ich ein Lehr-Methodenrepertoire?
- Bin ich bereit, fremde Unterrichtserfahrungen meiner Studenten durch Evaluationen aufzunehmen?
- Wie stark ist meine Identifikation mit meinem Dozentenberuf?
- Was ist mein persönlicher Stil, wie mein Temperament?
- Wie groß ist mein pädagogischer Eros – meine Zustimmung an die Studenten, wenn man so will, meine Liebe zu ihnen?
- Verfüge ich über eine kritische Distanz zum eigenen Handeln? – Bin ich kritikfähig?
- Habe ich eine Berufsethik? – Bin ich mir meiner Verantwortung bewusst?
- Kann ich Einfachheit in die juristische Komplexität bringen?